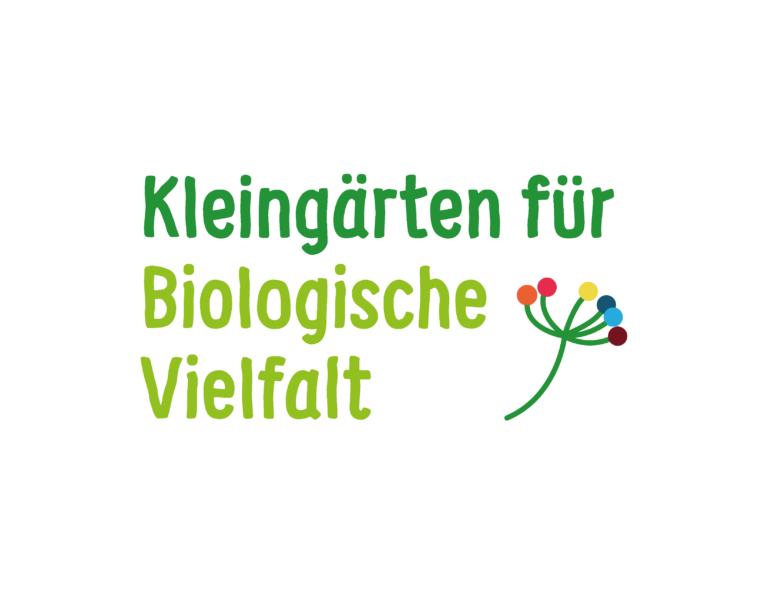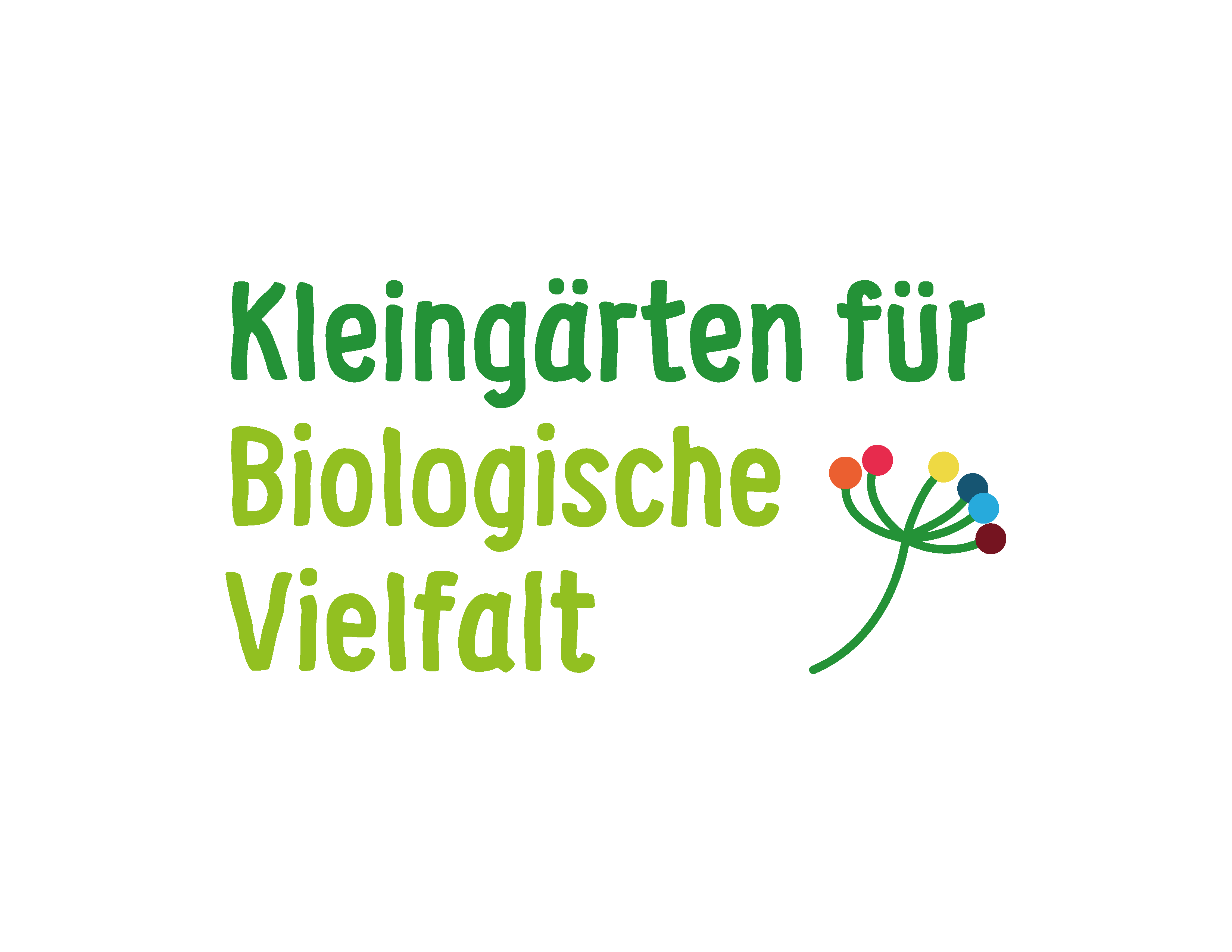Online Bildungs- und Vernetzungsreihe
Bodenbiodiversität für Kleingärten
Kleingärten profitieren von den Leistungen, die Bodenlebewesen im Verborgenen erbringen. Wir sind auf sie angewesen, aber können sie mit bloßem Auge kaum erkennen. Beim vierten Online-Bildungs- und Vernetzungstreffen am 09.12.2024 gab die Wissenschaftlerin Dr. Nicole Scheunemann einen Einblick, welche Vielfalt an Bodenorganismen unter unseren Füßen lebt. Sie gab außerdem Anregungen, wie wir die Vielfalt im Garten nutzen und schützen können.
Vielfalt der Bodenorganismen
Text: Dr. Nicole Scheunemann – Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz
Böden erfüllen wichtige Funktionen
Unsere Böden sind sprichwörtlich die Grundlage unseres Lebens. Doch der Boden ist auch Lebensraum für eine großartige Vielfalt von Bodenorganismen. Eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass weltweit knapp 60% aller Land-Lebewesen mindestens einen Teil ihres Lebens im Boden verbringen1. Diese Bodentiere, -pilze und -bakterien sind meistens klein und unscheinbar, doch sie erfüllen bzw. regulieren eine Vielzahl von Ökosystemleistungen, allen voran die Bereitstellung von Nährstoffen für Pflanzen und die Speicherung von Kohlenstoff. Ein gesunder Boden beherbergt eine große Vielfalt an Organismen, während diese gleichzeitig die Qualität des Bodens verbessern. Gärtner*innen profitieren von den Prozessen, die von den Bodenorganismen bereitgestellt und gesteuert werden, da diese Prozesse das Pflanzenwachstum verbessern bzw. erst ermöglichen. Organisches Material, das hauptsächlich aus abgestorbenen Pflanzenteilen besteht, verbessert die Bodenstruktur und erhöht die Nährstoff- und Wasserhaltekapazität des Bodens. Das macht den Boden auf natürliche Weise fruchtbar. Allgemein gilt: je größer die Artenvielfalt im Boden, desto effizienter sind die biologischen Prozesse, da verschiedene Organismen verschiedene Funktionen erfüllen und so noch das kleinste Stückchen Material abgebaut und dem Nährstoffkreislauf zugeführt werden kann.Bodenorganismen von Groß nach Klein
Die Wissenschaft unterteilt die Bodenorganismen zunächst in Größenkategorien. Dabei nimmt die Artenvielfalt mit abnehmender Körpergröße zu, d.h. je kleiner, desto artenreicher. Gleiches gilt für die Dichte der Organismen, also die Anzahl der Individuen pro Quadratmeter: während für einen einzelnen Maulwurf ein ganzer Garten als Territorium nötig ist, drängen sich in einem Komposthaufen gleich mehrere Tausend Regenwürmer, und von Mikroorganismen finden sich bereits in einem Teelöffel voll Boden Milliarden einzelner Zellen.
- Megafauna: Die größten Bodenlebewesen sind mit Wühlmaus und Maulwurf auch die bekanntesten, wenn vielleicht auch nicht die beliebtesten. Sie werden als Megafauna bezeichnet.
- Makrofauna: Eine Kategorie kleiner ist die Makrofauna. In diese Gruppe gehören Tiere, die noch leicht mit bloßem Auge zu erkennen sind, wie z.B. die Larven vornehmlich fliegender Insekten wie Käfer, Schmetterlinge, Fliegen und Mücken, aber auch Asseln, Tausend- und Hundertfüßer, sowie Spinnen und Schnecken. Auch die Freunde eine*r jeden Gärtner*in, die Regenwürmer, gehören in diese Kategorie. Ihre Grab- und Fraßtätigkeit ist für den Boden besonders wichtig.
- Mesofauna: Die Mesofauna ist mit einer durchschnittlichen Körpergröße von unter 2 mm schon nicht mehr ohne weiteres mit bloßem Auge zu beobachten. Doch sind es genau diese Arten, die einerseits den Abbau von organischem Material durch die Mikroorganismen beschleunigen, und die andererseits als Beutetiere eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz des Bodens spielen. Sie bewohnen die Hohlräume zwischen den Bodenpartikeln, die Bodenporen. In diese Gruppe gehören unter anderem verschiedene Milben, die Springschwänze und als „kleine Schwestern der Regenwürmer“ die Kleinringelwürmer.
- Mikrofauna: Mit Hilfe eines Mikroskops lassen sich noch kleinere Tiere im Boden entdecken, die Mikrofauna. Fadenwürmer und Rädertierchen sind hierbei die wichtigsten Gruppen. Im Gegensatz zu den größeren Vertretern der Bodentiere leben sie in den Wasserfilmen zwischen den Bodenpartikeln. Letztlich ist der Boden von einer unzählbaren Anzahl von Mikroorganismen bewohnt. Das sind einzellige Organismen, die entweder zu den tierischen Einzellern (Protisten), den Bakterien, Pilzen oder Algen gehören. Sie bewerkstelligen den Hauptteil der biochemischen Abbauprozesse im Boden, doch werden sie von den anderen Gruppen aktiviert und reguliert.
Bodenbiodiversität im Garten schützen
Doch wie stelle ich sicher, dass mein Gartenboden eine hohe Artenvielfalt an Bodenorganismen aufweist, wenn ich doch die meisten dieser Organismen nicht mit bloßem Auge sehen kann? Die Lösung ist einfacher als gedacht: wenn der Boden gute Lebensbedingungen bietet, gedeihen sie von ganz allein. Naturnahes Gärtnern macht dabei vieles richtig und kann als Leitlinie dienen:
- Pestizidfrei Gärtnern: Kein Einsatz von Pestiziden, denn was den „Schädlingen“ schadet, bringt auch die Bodentiere um.
- Permanente Bodendeckung: organisches Pflanzenmaterial ist die Nahrungsbasis des Bodennahrungsnetzes, entweder als Mulch oder in „lebendiger“ Form als Zwischensaat. Auf akkurat „sauberen“ Böden fehlt den Bodenorganismen die Nahrung. Die natürlichste Nahrungsgrundlage ist hierbei Laub.
- Kompostieren: Ein Komposthaufen ist organisches Material und damit Futter für die Bodentiere in konzentrierter Form: hier tummelt sich das Leben. Kompost ist damit auch jeder anderen Düngung vorzuziehen.
- Vielfalt bringt Vielfalt: von Monokulturen profitieren nur wenige Arten, während bei einer abwechslungsreichen Bepflanzung von Blumen- und Gemüsebeet viele Gruppen von Bodenorganismen versorgt werden.
- Einheimische Pflanzenarten bevorzugen: ähnlich wie Bestäuber(insekten) sind Bodenorganismen evolutionär an die heimische Pflanzenwelt angepasst. Organisches Material, das von einheimischen Pflanzen stammt, kann daher besser von ihnen verwertet werden als die Reste ursprünglich amerikanischer oder asiatischer Pflanzen.
- Reduzierte Bodenbearbeitung: Umgraben wirbelt die Bodenlebewesen durcheinander und zerstört das Gefüge der Bodenpartikel und vorhandene Regenwurmgänge. Ein oberflächliches Auflockern des Bodens oder tieferes Lockern ohne Wenden ist tiefem Umgraben daher vorzuziehen.
- Lebensräume schaffen: Bodenorganismen leben nicht nur im Beet, sondern auch in (bzw. unter) der Wiese, in Laub-, Holz- und Steinhaufen. Vor allem die Arten der Makrofauna finden hier Zuflucht vor Sonne, Hitze und Räubern.
Weiterführende Infos
Der Boden lebt! Bodenschutz im Kleingarten:
Die Neu-Auflage der BKD-Broschüre „Der Boden lebt! Bodenschutz im Kleingarten“ gibt vertiefende Einblicke ins Einmaleins der Bodenkunde, zum Boden im Klimawandel und natürlich zur richtigen Bewirtschaftung des Bodens im Kleingarten.
Wer visuell in die Schönheit der Bodenlebewesen eintauchen möchte, kann dies hier tun: www.chaosofdelight.org
Fußnoten & Quellen
1 Natur und Landschaft Ausgabe 09/10-2024 Schwerpunkt: Schutz des Bodenlebens
1 Anthony, Mark A., S. Franz Bender, and Marcel GA van der Heijden: Enumerating soil biodiversity. Proceedings of the National Academy of Sciences 120.33 (2023). DOI: 10.1073/pnas.2304663120